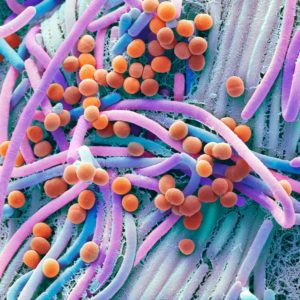Es gibt nichts, was es nicht gibt. Undschon gar nichts, was sich Stephen King nicht schon einmal vorgestellt hat. Zum Beispiel ein Vampir, der eine Kleinstadt unterwandert („Brennen muss Salem“, 1975), ein Kind, das wegen pyrokinetischer Fähigkeiten vom Geheimdienst gejagt wird („Feuerkind“, 1980), ein Ufo, dessen Fracht eine ganze Stadt um den Verstand bringt („Das Monstrum“, 1987). Aus unschuldigen Highschool-Abschlussbällen, winterlich stillen Luxushotels und idyllischen Kleinstädten kreiert Stephen King Zwischenorte voller Grauen. Mehr als 50 Romane und über 100 Kurzgeschichten, Novellen und Drehbücher hat der Amerikaner in den letzten 46 Jahren veröffentlicht. Und seine mitunter auch gesellschaftskritischen Texte sind Teil unseres kollektiven Unterbewusstseins geworden. Das verdeutlicht das Porträt „Stephen King – Das notwendige Böse“, das ARTE im Oktober zeigt.
Anders als bei vielen anderen Horrorgeschichten verfliegt das Unbehagen, das sich bei King einstellt, nicht mit dem nächsten Sonnenaufgang. Er zwingt seine Leser, zu erkennen, dass das Grauen in ihnen selbst steckt. Wie Pennywise, das „Es“ (1986) aus der Kanalisation der Kleinstadt Derry, konfrontiert er die Leser mit den größten Ängsten: davor, die Kontrolle zu verlieren, den Verstand oder einen geliebten Menschen.
Dabei schreibt King nicht, um zu erschrecken. Er plant keine Schockeffekte, nutzt keine unerwarteten Wendungen. Er konstruiert nicht, sondern lässt sich beim Schreiben von seinen Figuren leiten.
Seinen ersten Roman schloss der 1947 im ländlichen Maine geborene Autor mit gerade mal 17 Jahren ab. Unter dem Titel „Amok“ und dem Pseudonym Richard Bachman wird dieser aber erst 1977 veröffentlicht. Da ist King dank „Carrie“ (1974) bereits Bestseller-Autor. Im selben Jahr erscheint mit „The Shining“ sein wohl bekanntestes Werk. Darin verfällt der alkoholabhängige Schriftsteller Jack Torrance in der Einsamkeit eines leer stehenden Hotels immer mehr dem bösen Geist des Gebäudes und somit dem Wahnsinn, unfähig, sein Werk zu beenden.
„Am besten kann ich schreiben, wenn mir meine Geschichten vertraut sind“, erklärt King in seinen Memoiren „Das Leben und das Schreiben“ (2000). Deshalb behandelt er in seinen Texten auch die eigenen Ängste. King weiß, wie sich eine Schreibblockade anfühlt. Und wie es ist, süchtig zu sein – bis Mitte der 1980er Jahre war der Schriftsteller selbst alkohol- und kokainabhängig.
Diffuse Angst oder konkrete Furcht
Aber Kings Kreativität entwickelt sich nicht nur aus dem persönlichen Erleben, sondern auch aus Ängsten seiner Generation. Zwar war die unmittelbare Furcht vor dem Krieg bereits gebannt, als er geboren wurde, an ihre Stelle war jedoch die diffusere Angst vor der Bombe getreten. In Comics und Pulp-Magazinen, vor allem aber im Kino war die Bedrohung durch den Atomtod omnipräsent. In „Formicula“ (1954) von Gordon Douglas verwüsten durch Atomtests mutierte Riesenameisen ganze Städte. Und in „Der Tod hat schwarze Krallen“ (1957) von Gene Fowler Jr. macht ein verrückter Wissenschaftler einen Jugendlichen zum Werwolf. Diese Scifi-Horror-Hybride bebilderten das Unbehagen gegenüber Wissenschaft und Technik, das mit dem Kalten Krieg entstanden war. Diese Werke inspirierten Stephen King, den Horror im Alltäglichen zu sehen – im Auto eines Außenseiters, das ein eifersüchtiges Eigenleben entwickelt („Christine“, 1983), oder im Reality-Fernsehen, dessen Voyeurismus auch vor dem Überlebenskampf eines Menschen nicht haltmacht („Menschenjagd“, 1982).
Stephen King zeigt, wie brüchig die Fassade der Zivilisation ist, hinter der unsere Monster hausen. Seine Geschichten sind „Was wäre wenn …“-Gedankenspiele, die den Leser in ihren Bann ziehen, weil er merkt, dass auch der Autor nicht weiß, was denn wäre, wenn. Die Hypothesen sind dabei gesellschaftskritischer, als man dem Horrorgenre gemeinhin zugestehen mag. King schreibt keine politischen Allegorien, jedoch immer als politischer Mensch und aufmerksamer Beobachter seiner Gegenwart. Er scheut sich nicht, dabei Übernatürliches mit Allzumenschlichem zu verknüpfen: Geister und Gier, Pyromanie und Pubertät, Vampire und Verlustängste.
Nie jedoch lässt King seine Leser mit dem Unbehagen, das solche Gedankenspiele auslösen, allein. In seinen Geschichten steckt auch Hoffnung. Nicht darauf, dass sie ein glückliches Ende finden. Dafür ist King seinem Genre zu treu. Gegen das Böse zu gewinnen, das gelingt seinen Protagonisten fast nie. Aber King ist Menschenfreund genug, ihnen zu gewähren, sich dem Bösen zumindest erfolgreich zu verweigern – auch wenn sie es nicht besiegen können.
Am besten kann ich schreiben, wenn mir meine Geschichten vertraut sind