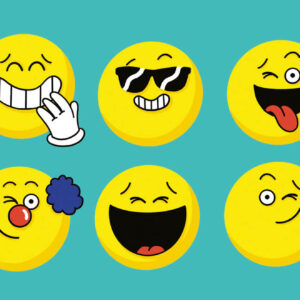Es ist das erstaunlichste Leben unseres Jahrhunderts, jenem Goethes vergleichbar“, schrieb 1953 eine Schweizer Zeitung über Thomas Mann. Der übertrug die Passage in sein Tagebuch und notierte: „Fiel mir auch schon auf.“ Es war ein Vergleich nach Manns Geschmack, denn mit niemandem maß er sich lieber als mit Johann Wolfgang von Goethe. Dementsprechend betrieb er viel Aufwand, um sein Image als Dichter und Monument zu pflegen. Der Wille zu Gravitas, der Hang zu ausholendem Stil und Schachtelsätzen – liegt er uns heute fern? Offenbar nicht, denn Manns Bücher werden noch immer weltweit gelesen, neu aufgelegt. Und es dürfte kein Zufall sein, dass sich plötzlich diverse zeitgenössische Autoren an Ideen aus seinem Roman „Der Zauberberg“ (1924) abarbeiten.
Der Verdacht liegt nah, dass es mit dem Gefühl zu tun haben könnte, eine bekannte Normalität gehe auf ihr Ende zu. Wie eben im „Zauberberg“, dieser Geschichte einer Welt am Abgrund (die dennoch oft sehr komisch ist). Der durchschnittliche Held Hans Castorp begibt sich darin in ein Sanatorium in den Alpen; er will ein paar Wochen bleiben, am Ende werden sieben Jahre daraus. Oft zitiert wird derzeit das Kapitel zur großen Gereiztheit, die irgendwann in die betuliche Atmosphäre der Bergklinik einbricht: „Eine allgemeine Neigung zu giftigem Wortwechsel, zum Wutausbruch, ja zum Handgemenge.“ Die Nerven liegen frei. Das dürfte vielen vertraut vorkommen, die sich in öffentlichen Verkehrsmitteln oder auf Social Media bewegen. Bei Mann flippen selbst unauffälligste Charaktere aus, weil ihnen der Tee zu kalt ist.
Thomas Mann, Jahrgang 1875 und Sohn einer angesehenen Lübecker Kaufmannsfamilie, hatte stets den Willen zur Kunst besessen. Er betrieb sie in den festen Bahnen eines bürgerlichen Lebens – ein Gegensatz, an dem er sich zeitlebens rieb. Das Dämonische und das Schöpferische seien verbunden, heißt es etwa in „Doktor Faustus“ (1947), der Geschichte eines Teufelspaktes. Bücher wie „Buddenbrooks. Verfall einer Familie“ (1901) und „Tod in Venedig“ (1912) handeln vom Niedergang, den man vielleicht Manns frühes Spezialgebiet nennen kann. Er war nicht nur ein Beobachter, der sein direktes Umfeld im Schreiben verarbeitete – oft mit ironischem Einschlag und selten zur Freude der Porträtierten. Er absorbierte auch kleinste gesellschaftliche Verschiebungen.
Dass er seine Arbeit mit nahezu heiligem Ernst tat, ist bekannt. Seit dem Erfolg der „Buddenbrooks“ und erst recht, nachdem er im Jahr 1929 den Literaturnobelpreis erhalten hatte, war Mann als Institution etabliert. Sein Leben trug filmreife Züge: mit einer herrschaftlichen Villa in München und sechs Kindern, von denen einige einen ausschweifenden Lebensstil hatten. Als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, folgten Flucht und Neuanfänge in Südfrankreich, Kalifornien und der Schweiz. Nach Deutschland kehrte Mann auch nach Kriegsende nur wenige Male zurück. Zu tief saß der Schock.
Tatsächlich ist es auch Thomas Manns politisches Engagement, dem nun, im Jubiliäumsjahr zum 150. Geburtstag, neue Aufmerksamkeit zukommt. Da sind beispielsweise die Radioansprachen, die er im Exil in Los Angeles fünf Jahre lang für die BBC aufnahm und die nun unter dem Titel „Deutsche Hörer!“ erneut veröffentlicht wurden. Darin richtet sich Mann an sein Heimatland; er wettert und fleht es an, sich gegen die Nazis zu wenden. Er spricht über Konzentrationslager. Nennt Hitler „eine hohle Null“ und „die abstoßendste Figur, auf die je das Licht der Geschichte fiel“. Dass seine Mitmenschen ihm folgten, sich gegen Menschlichkeit und Kultur entschieden, machte ihn fassungslos.
Die Familie als Thinktank
Öffentlichkeit fand Mann auch in seiner neuen Heimat, den Vereinigten Staaten. Dort galt er als „public intellectual“, sagt der Literaturwissenschaftler Friedhelm Marx, Professor an der Universität Bamberg, im Gespräch mit dem ARTE Magazin. Also als Intellektueller, der sich in gesellschaftliche Debatten einschaltet. „Wie wenige andere Autoren des Exils hat er es verstanden, diese Rolle in den USA fortzuführen.“ Immer stärker habe er dabei auf den Input seiner Familie vertraut. Die Kinder Erika, Klaus und Golo, seine Frau Katia und auch sein Bruder Heinrich Mann gaben Impulse. „Spätestens in den 1940er und 1950er Jahren war die Familie eine Art Thinktank.“
Das Bild des einsamen Denkers am Schreibtisch kann da zumindest zum Teil als überholt gelten. Prinzipiell war es die Veröffentlichung von Manns Tagebüchern ab 1975, 20 Jahre nach seinem Tod, die das Image des Autors änderte. Es weichzeichneten – oder seiner berühmten Zugeknöpftheit doch etwas Rührendes verliehen. Man las von heimlicher Verliebtheit in junge Männer, von Verstimmungen, Hoffnungen und allerlei Vorfällen banalerer Art: „Das Frühstück im Bett bot wenig Vorteil, ist unbequem und soll nicht wiederholt werden.“ Die Aufzeichnungen zeigten Mann als Privatmenschen. Nicht als Arbeitsmaschine, sondern als gelegentlichen Trödler im Homeoffice. Wohl auch darum waren manche Einzeiler aus den Tagebüchern auf Twitter zuletzt so erfolgreich, dass der S. Fischer Verlag sie als Buch auflegte. Im August 1948 etwa notierte Thomas Mann: „Große Abneigung, nachmittags noch irgend etwas zu tun.“ Und wer könnte es nicht nachempfinden? Ein typisches Jahresanfangsgefühl befiel ihn im Januar 1954. Es ist von angemessener Knappheit: „Schon Monatsmitte. Erschreckend.“